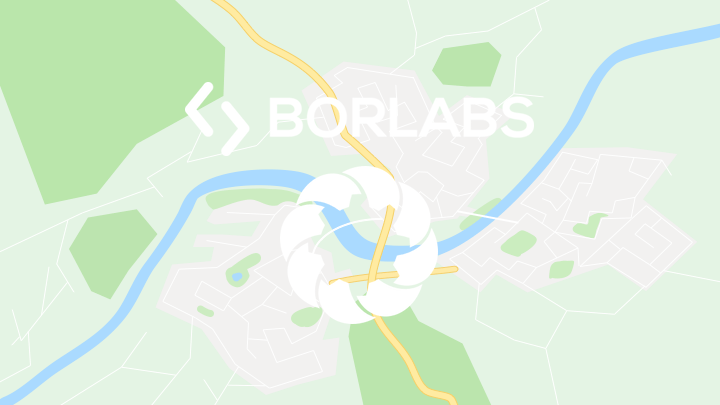Was versteht man unter Schallausbreitung?
Finden Schallwellen den Weg zu unserem Ohr, nehmen wir diese als Töne oder Geräusche wahr. Manchmal lässt sich der Schall zudem als Erschütterung spüren oder beobachten, denn Schall ist das Ergebnis einer Druckstörung, durch die die Luft zunächst verdichtet und dann wieder verdünnt wird. Auf diese Weise entstehen Schwingungen bzw. Schallwellen, die sich vom Schallerreger fortbewegen.
Mit bloßem Auge erkennen lassen sich Schallwellen und ihre Ausbreitung nicht, man kann sie mithilfe von Schwingungsanzeigern aber visualisieren. Die Aufzeichnung gibt Auskunft darüber, mit welcher Amplitude sich der Schall ausbreitet, also in welcher Lautstärke. Je größer die Amplitude, desto lauter ist das Schallereignis.
Auch die Frequenz, also die Tonhöhe, lässt sich mit einem Schwingungsanzeiger ermitteln. Dazu misst man die Zeit und die Häufigkeit, in der die Schwingung ansteigt. Je häufiger dies geschieht, desto höher ist die Frequenz beziehungsweise der Ton, den wir durch die Schallausbreitung wahrnehmen.
Ein natürlicher „Schwingungsanzeiger“ ist unser Ohr. Hier wird der Schall zum Trommelfell geleitet, das darüber ebenfalls in Schwingung gerät. Als elektrischer Impuls wird der Schall dann ans Großhirn weitergeleitet und dort verarbeitet. Problematisch wird dies, wenn ein starkes Nachhallen von verschiedenen Schallquellen verhindert, dass wir beispielsweise die Stimme unseres Gesprächspartners klar herausfiltern können.
Schallausbreitung einfach erklärt
Damit es zur Schallausbreitung kommt, benötigt der Schall ein Medium, über das er sich verbreiten kann – also beispielsweise die Luft, deren Druck sich durch den Auslöser abwechselnd verdichtet und verdünnt. Das Medium entscheidet auch darüber, in welcher Wellenform sich der Schall fortbewegt – in der Luft geschieht dies in Längswellen, die in Ausbreitungsrichtung verlaufen.
Wird der Schall nicht durch Hindernisse oder Wetterereignisse umgeleitet, erfolgt die Schallausbreitung gleichmäßig vom Druck-Ereignis fort in alle Richtungen. So entsteht ein Schallfeld, innerhalb dessen das Geräusch wahrgenommen werden kann. Wird er zurückgeworfen – wie zum Beispiel von einer Gebirgswand –, erklingt ein Echo.
Die Schallausbreitung erfolgt zudem in einer bestimmten Geschwindigkeit zeitlich versetzt zum Auslöser – man kennt dies vom Gewitter, bei dem Donner und Blitz eigentlich gleichzeitig entstehen, aber nacheinander wahrgenommen werden. Die Geschwindigkeit, mit der sich Schall ausbreitet, liegt bei etwa 333 bis 344 Meter/Sekunde.
Während manche Stoffe und Umstände den Schall verstärken oder reflektieren, verringern (absorbieren) andere ihn. So breitet sich Schall im Wasser besonders gut aus. Und wer als Kind schon einmal versucht hat, das Gespräch der Eltern im Nebenzimmer zu belauschen, weiß, dass ein einfaches Trinkglas oder eine Tasse die Schallwellen sogar durch die Zimmerwand hörbarer machen kann. Denn Glas, Kacheln, Beton oder andere harte und glatte Materialien können ein Geräusch oder Dauerlärm intensivieren. Weiche Materialien wie Teppiche dagegen verringern die Intensität der Schallausbreitung.
Was fördert und was verringert die Schallausbreitung im Raum?
Verschiedene Faktoren entscheiden also darüber, wie intensiv wir Lärm wahrnehmen. Die Intensität ist abhängig davon, ob sich der Schall im Freien oder im Raum ausbreitet, über welches Medium er sich verbreitet und auf welche Materialien er trifft. Harte und glatte Materialien sorgen dafür, dass er im selben Winkel zurückgeworfen wird, in dem er eingetreten ist. Durch diese Reflektion des Schalls entsteht zusätzlich das, was wir als Nachhall bezeichnen.
Deshalb ist das Badezimmer meistens ein guter Raum zum Singen, in einem mit Teppich ausgelegten Wohnzimmer dagegen ist die Akustik eher schlecht, weil der satte Hall verschluckt wird. Umgekehrt ist ein Raum, der aufgrund seiner Ausstattung und der Baumaterialien viel Nachhall zulässt, denkbar ungeeignet als Ruheraum, als Büro, als Seminar- oder Konferenzraum.
Gerade in solchen Räumen aber sind – ähnlich wie in Arztpraxen, Kindertagesstätten oder Produktionshallen – Materialien wie Teppiche, Textilien und Polstermöbel natürlich denkbar ungeeignet, um Schall und Nachhall zu verringern. Die Einhaltung von Hygienevorschriften steht dem ebenso entgegen wie der Wunsch nach einer modernen und attraktiven Gestaltung.
Eine Lösung besteht darin, die Schallausbreitung und den unangenehmen Nachhall durch schallabsorbierende Komponenten zu verringern, die den Raum zugleich ästhetisch aufwerten und/oder ihn mithilfe von Designelementen strukturieren. Eine Auswahl passender Produkte finden Sie in unserem Onlineshop. Gerne beraten wir Sie dazu auch persönlich.